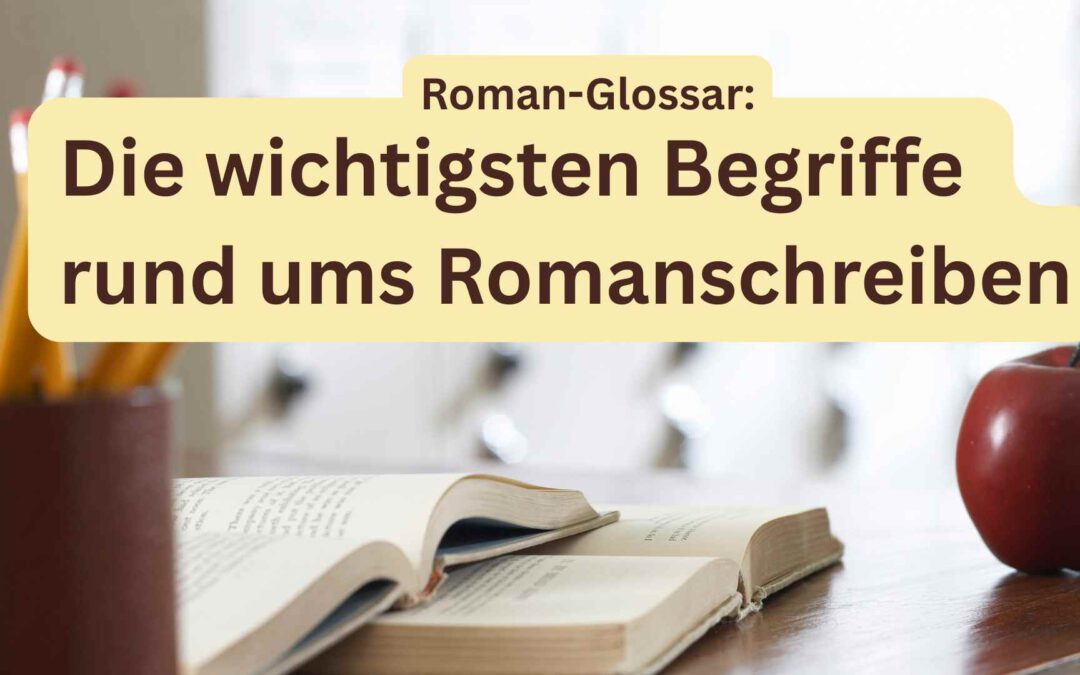Du schreibst einen Roman und stolperst ständig über Begriffe wie Plotpoint, Heldenreise oder Show, don’t tell? Willkommen im Dschungel des Schreibhandwerks! In diesem Glossar findest du die wichtigsten Begriffe rund ums Romanschreiben – klar und anschaulich erklärt. Egal ob du gerade mit deinem ersten Roman startest oder schon mitten in der Überarbeitung steckst: Hier bekommst du schnellen Überblick und handfestes Wissen für dein Schreibprojekt.
All-is-lost-Moment
Der Tiefpunkt der Geschichte, an dem wirklich alles für die Hauptfigur verloren scheint. Nicht nur das äußere Ziel, sondern auch das, nachdem sie sich auf einer inneren Ebene sehnt, um endlich Frieden und Heilung zu erfahren. Dieser „All-is-lost-Moment“ passiert meist nach ungefähr 75 Prozent der Geschichte. Kein guter Roman kommt ohne diesen Punkt aus, an dem die Leserschaft denkt, dass jetzt alles aus und vorbei ist. Wichtig ist, dass du für deine Figur hier wirklich das Schlimmste passieren lässt (auch wenn es dir selbst weh tut).
Denn ohne den Tiefpunkt (auch: „Dark Night of the Soul“ genannt) würde der Kontrast zum Wachstum, zum möglichen Sieg fehlen. Die Figur muss gezwungen werden, eine fundamentale Entscheidung zu fällen: Bleibe ich am Boden – oder stehe ich auf? Merkmale eines guten Tiefpunkts sind: Die Figur verliert etwas Entscheidendes (Person, Traum, Glaube, Selbstbild), es gibt kein klares „Weiter so“. Der Moment zwingt die Figur zur Innenschau: Wer bin ich? Was jetzt? Die Figur trifft danach eine aktive Entscheidung – die zum Wendepunkt führt und ihrer Reifung führt.
Die 12 wichtigsten Bausteine für einen starken Plot
Mehr Struktur,
mehr Spannung,
mehr Storymagie
Strukturiere deinen Roman wie ein Profi!
Dieses kostenlose Freebie hilft dir dabei, Struktur und emotionale Tiefe in dein Romanprojekt zu bringen. Perfekt fürs Plotten und Überarbeiten – mit Leitfragen, Beispielen und Aha-Momenten.

Antagonist
Der Gegenspieler der Hauptfigur. Es kann der Bösewicht sein, muss es aber nicht. Antagonist kann auch einfach der wichtigste „Pingpong“-Partner sein. Im Liebesroman ist der Antagonist zum Beispiel der Love Interest. In einem epischen Fantasyroman kann es der böse Magier sein. Es gibt aber auch antagonistische Kräfte, die nicht menschlich sind, zum Beispiel ein Gesellschaftssystem, eine Naturgewalt oder ein innerer Konflikt. Ich empfehle immer, nicht nur einen Hauptantagonisten zu erfinden, sondern daneben weitere antagonistische Kräfte im Außen im Innern der Hauptfigur, also auf verschiedenen Ebenen. Das macht deinen Roman besonders plastisch und realitätsnah.
Auslöser
Das zentrale Ereignis zu Beginn deines Romans, das die Geschichte erst ins Rollen bringt. Davor läuft alles irgendwie für deine Hauptfigur – gut oder schlecht, aber immerhin konstant. Und dann passiert etwas. Etwas, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das auslösende Ereignis (auch “inciting incident”) ist der Moment in der Geschichte, in dem etwas Unerwartetes, Einschneidendes oder Verstörendes passiert – und deine Figur aus dem Alltag schleudert.
Es kann etwas Dramatisches sein (zum Beispiel eine Nachricht oder Einladung, ein Angriff, ein Unfall oder ein Verbrechen, ein Geheimnis wird enthüllt, ein Verlust …) Oder etwas ganz Kleines (eine Begegnung, das zufällige Hören eines Gesprächs …), das aber dramatisch und folgenreich ist. Ich finde diesen Merksatz immer sehr hilfreich: Je klarer der Auslöser, desto stärker der Sog der Geschichte.
Backstory
Die Vorgeschichte deiner Figuren – all das, was vor dem eigentlichen Roman passiert ist und sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie jetzt sind. Sie umfasst prägende Erlebnisse, Beziehungen, Traumata, Erfolge, Verluste, Werte und Überzeugungen. Die Backstory ist der Schlüssel zur Figurenentwicklung: Sie erklärt, warum eine Figur so handelt, wie sie handelt, warum sie bestimmte Ängste oder Sehnsüchte hat – und warum ihr Ziel im Roman für sie so wichtig ist. Ihre Vergangenheit ist die Wurzel ihrer Motivation, ihres inneren Konflikts und letztlich auch ihrer Veränderung.
Eine gut durchdachte Backstory sorgt außerdem dafür, dass die Romanhandlung logisch und emotional stimmig wirkt. Wenn du weißt, was deine Figur geprägt hat, triffst du bessere Entscheidungen für Plot, Reaktionen und Wendepunkte. Beschäftige dich intensiv mit der Vergangenheit deiner Figuren – selbst wenn du nur einen Bruchteil davon im Roman erwähnst. Die Backstory ist wie das Fundament eines Hauses: Man sieht sie nicht immer, aber ohne sie stürzt alles ein.
Cliffhanger
Ein offenes Ende – meist am Kapitel– oder Szenenende –, das Leser:innen mitten in der Spannung hängen lässt. Eine Frage bleibt unbeantwortet, ein Ereignis wird abrupt gestoppt oder eine Enthüllung steht kurz bevor. Das Ziel: weiterblättern um jeden Preis. Beispiel: „Sie öffnete die Tür – und erstarrte.“ Schnitt. Neues Kapitel, bei mehreren Perspektivfiguren kannst du jetzt mit der anderen Perspektive weitermachen. Deine Leser:innen werden vor Spannung erzittern und auf jeden Fall weiterlesen, denn sie müssen wissen, was die Figur gesehen hat.
Cliffhanger wirken aber nur, wenn du sie dosiert einsetzt. Zu viele davon stumpfen ab – Leser:innen merken schnell, wenn sie ständig an der Nase herumgeführt werden. Und auch noch ganz wichtig: Löse den Cliffhanger bald auf – sonst verlieren deine Leser:innen das Vertrauen und fühlen sich veräppelt. Der beste Cliffhanger ist nicht einfach ein Schockmoment, sondern ein emotionaler Haken: Etwas, das uns fühlen lässt, dass noch etwas Bedeutendes kommen muss.
Erzählperspektive
Bestimmt, aus wessen Blick und Bewusstsein eine Geschichte erzählt wird – also, wer sie erzählt und wie nah Leser:innen an den Figuren dran sind. Sie prägt Ton, Wirkung und emotionale Tiefe deines Romans. Die drei wichtigsten Varianten sind die Ich-Perspektive, die personale und die auktoriale Perspektive.
In der Ich-Perspektive erzählt die Figur selbst. Leser:innen stecken direkt in ihrem Kopf, hören ihre Gedanken und spüren ihre Gefühle hautnah. Diese Perspektive schafft intensive Nähe und funktioniert besonders gut in Liebesromanen, Entwicklungsromanen oder psychologisch geprägten Geschichten. Ihr Nachteil: Die Figur weiß nur, was sie erlebt oder denkt – du kannst also keine parallelen Handlungsstränge zeigen. Außerdem steht und fällt der Text mit der Stimme des Ich-Erzählers: Wenn sie langweilig oder zu selbstbezogen klingt, verliert der Text schnell an Spannung.
Der personale Erzähler erzählt aus der Wahrnehmung der Figur heraus in der 3. Person Singular (er, sie). Leser:innen sehen und fühlen, was diese Figur erlebt . Das schafft emotionale Nähe, erlaubt aber etwas mehr Flexibilität als die Ich-Perspektive. Du kannst in deinem Roman mehrere Figurenperspektiven nutzen, solange du sie klar trennst (am besten szenen- oder kapitelweise). Der häufigste Fehler hier ist das sogenannte Head-Hopping – also das unklare Hin- und Herspringen zwischen Köpfen. Das solltest du unbedingt vermeiden.
Der auktoriale Erzähler steht über allem, ist allwissend und kein Teil der Romanhandlung: Er kennt aber Vergangenheit, Zukunft, Gedanken aller Figuren – und kommentiert, erklärt oder bewertet immer wieder. Diese Perspektive gibt dir große Freiheit und Überblick, kann aber Distanz schaffen, weil Leser:innen nicht mitfühlen, sondern eher zusehen.
Fallhöhe
Das, was für deine Hauptfigur auf dem Spiel steht, auch Einsatz, Risiko oder Konsequenz genannt. Die Fallhöhe ist der Grund, warum deine Leserschaft mitfiebert, ob deine Hauptfigur ihr Ziel erreicht oder nicht. Frage dich bei der Planung deines Romans deshalb unbedingt: Was passiert, wenn deine Figur ihr Ziel nicht erreicht? Was steht auf dem Spiel – emotional, körperlich, gesellschaftlich, moralisch? Wenn nix Schlimmes droht, dann wird der Leserschaft deine ganze Geschichte egal sein. Wenn die Figur ihr Ziel verfehlen und trotzdem weiterleben kann, fehlt die emotionale Fallhöhe.
Es gibt große handlungsbezogene Risiken (der Schatz wird nicht gefunden, der Mörder nicht gefasst …) und innere Fallhöhen (die Figur verliert ihren Selbstwert, bleibt für immer in der Opferrolle, wird von ihrer Familie ausgestoßen …). Gute Romane verschmelzen die großen handlungsbezogenen Risiken mit einer inneren Fallhöhe. Das packt die Leserschaft am meisten, denn dann wird es emotional.
Figurensprache
Die ganz eigene Sprechweise der wichtigsten Figuren im Roman. Das ist wichtig, um sie zu charakterisieren und sie voneinander zu unterscheiden. Finde einen eigenen Ton, ein eigenes Vokabular, damit die Figur unverwechselbar wird. Du kannst zum Beispiel die soziale Herkunft und das Umfeld, die Beziehung zu den Eltern oder die Art des Berufes klären, denn das beeinflusst die Sprache der Figur. Ein Arbeiter spricht anders als ein Professor. Ein Künstler anders als ein eingefleischter Naturwissenschaftler. Jemand, dessen Eltern viel kommunizieren und gerne Bücher lesen, wird mit einer anderen Sprache aufgewachsen sein als ein Kind, dem oft nicht zugehört wurde und das bei Tisch ruhig zu sein hatte.
Wenn du aus der Vergangenheit der Figuren heraus weißt, wie sie ticken, welche Hobbys und Leidenschaften für sie typisch sind, welche Bildung sie genossen haben, dann kannst du sie unterschiedlich sprechen lassen. Viele glauben, dass sich Figurensprache nur im Dialog mit anderen zeigt. Aber das ist ein Irrglaube. Achte darauf, dass du die Figurensprache auch in den Gedanken der Figuren zeigst, wenn du diese zum Beispiel durch einen inneren Monolog abbildest. Denke aber daran, es mit Besonderheiten nicht zu übertreiben, denn sonst wirken Dialoge schnell überzogen und sind nicht mehr gut lesbar.
Figurenentwicklung
Beschreibt die Veränderung einer Figur im Verlauf der Geschichte – also, wie sie durch Erfahrungen, Konflikte und Entscheidungen zu einem anderen Menschen wird als zu Beginn. Sie ist kein schmückendes Beiwerk, sondern der Kern fast jeder Geschichte: Ohne Entwicklung kein emotionaler Bogen. Eine gute Figurenentwicklung entsteht, wenn äußere Ereignisse innere Bewegung auslösen. Die Figur steht vor einer Herausforderung, die ihre bisherigen Überzeugungen infrage stellt. Sie trifft Entscheidungen, scheitert, lernt – und verändert dadurch ihr Verhalten, ihre Haltung oder ihren Blick auf sich selbst.
Entwicklung bedeutet nicht automatisch „vom Schwachen zum Starken“. Es kann genauso gut heißen: jemand erkennt eine Wahrheit, lässt etwas los oder akzeptiert, was er nicht ändern kann. Entscheidend ist, dass die Veränderung nachvollziehbar und konsequent aus Handlung und Motivation erwächst – nicht aus Zufällen oder plötzlichen Eingebungen.
Foreshadowing
Im Deutschen „Vorausdeutung“, bedeutet, dass du später wichtige Ereignisse schon früh im Roman andeutest. Das können kleine Details, Sätze, Handlungen oder Symbole sein, die erst rückblickend Bedeutung bekommen. Eine Figur schenkt jemandem zum Beispiel beiläufig ein Feuerzeug – viele Kapitel später rettet genau dieses Feuerzeug ihr das Leben.
Oder: Eine Nebenfigur sagt am Anfang der Geschichte, „Ich hab ein schlechtes Gefühl bei dem alten Steg“, und am Ende bricht dieser Steg tatsächlich zusammen.
Foreshadowing schafft Kohärenz und Spannung, weil es Leser:innen das Gefühl gibt, dass die Handlung folgerichtig ist und nichts zufällig passiert. Es funktioniert auf zwei Ebenen. Einmal inhaltlich, als konkrete Vorbereitung auf ein Ereignis (z. B. eine Verletzung, ein Verrat, ein Tod). Und dann auch emotional: als leise Vorahnung, dass sich etwas verändern oder zuspitzen wird. Wichtig ist, dass die Hinweise unauffällig bleiben. Wenn du sie zu deutlich setzt, nimmst du die Spannung vorweg. Lies beim Überarbeiten gezielt nach Momenten, die du verstärken oder vorwegnehmen kannst. Ein gelungenes Foreshadowing fällt erst beim zweiten Lesen auf – und fühlt sich dann völlig selbstverständlich an.
Head-Hopping
Ein häufiger Perspektivfehler in Romanen. Gemeint ist damit das unmotivierte Hin- und Herspringen zwischen den Gedanken und Gefühlen mehrerer Figuren innerhalb einer einzelnen Szene oder sogar eines Absatzes. Für Leser:innen entsteht dadurch schnell Verwirrung: Sie wissen nicht mehr, wessen Sichtweise sie gerade erleben sollen – und verlieren den emotionalen Anschluss. Ein klassisches Beispiel: „Lenas Herz schlug schneller. Würde er sie endlich küssen? Tim schob die Hände in die Taschen seiner Jeans. Wollte sie seine Nähe überhaupt?“ → Hier befinden wir uns zuerst in Lenas Gefühlswelt – und plötzlich, ohne Bruch oder Abstand, in Tims Gedanken. Das ist Head-Hopping.
Warum ist das problematisch? Ein Roman lebt von der emotionalen Nähe zur Hauptfigur. Leser:innen brauchen einen klaren Anker – eine Perspektivfigur, durch deren Augen sie das Geschehen erleben. Wenn die Perspektive unklar oder ständig wechselnd ist, entsteht Distanz statt Nähe. Der Text wirkt dann unruhig, instabil und manchmal auch unfreiwillig komisch. Vermeiden kannst du Head-Hopping, indem du dich bewusst für eine Perspektivfigur entscheidest und nur zeigst, was diese wahrnehmen, denken und fühlen kann. Bleibe dabei in ihrer Innenwelt, auch wenn andere Figuren dabei sind. Wenn du die Perspektive wechseln möchtest: Mach einen klaren Szenen- oder Kapitelwechsel.
Heldenreise
Ein Plotmodell für Figurenentwicklung und Dramaturgie, das beschreibt, wie eine Hauptfigur durch Herausforderungen wächst und sich verändert. Das Modell geht auf den Mythenforscher Joseph Campbell zurück, der in The Hero with a Thousand Faces (1949) die Struktur vieler Erzählungen untersuchte und dabei 17 Stationen identifizierte. Später vereinfachte der Drehbuchautor Christopher Vogler das Modell für das moderne Storytelling – seine Version umfasst 12 Stationen, die heute in Romanen, Filmen und Serien am weitesten verbreitet sind. Sein Buch „Die Odyssee des Drehbuchschreibers“ ist für alle Romanschreibenden absolut empfehlenswert.
Im Kern zeigt die Heldenreise den Weg einer Figur vom gewohnten Leben in eine neue, unbekannte Welt. Dort muss sie Prüfungen bestehen, an Grenzen gehen, scheitern, lernen – und kehrt am Ende verwandelt zurück. Sie ist damit ein Modell, das äußere Handlung und innere Entwicklung miteinander verknüpft. Die Heldenreise hilft, den emotionalen Bogen einer Geschichte zu strukturieren, ohne sich in reiner Ereignislogik zu verlieren. Sie macht sichtbar, wann die Figur aktiv wird, wann sie an sich zweifelt und wann sie sich verändert.
Info-Dump
Bezeichnet die übermäßige und oft unnatürlich wirkende Anhäufung von Hintergrundinformationen innerhalb einer Szene – meist in Form von langen Erklärabsätzen oder erzwungenen Dialogen. Typisch ist: Der Erzählfluss wird unterbrochen und du gibst möglichst viel Weltwissen, Figurenbiografie oder Setting-Details auf einmal. Oder eine Figur erklärt einer anderen etwas, was diese längst wissen müsste – nur damit Infos an die Lesenden gelangen. Das überfordert und langweilt – vor allem, wenn die Infos gerade nicht wichtig für die Handlung oder das emotionale Erleben sind.
Besser: Streue Hintergrundinfos gezielt und szenisch ein, wenn sie jetzt für die Figur oder den Konflikt eine Bedeutung haben. Nutze Show don’t tell, Symbolik oder Andeutungen und denke in Portionen statt Paketen. Gute Romane liefern Informationen durch Spannung, Handlung und Reaktion – nicht durch Vortrag.
Kapitel
Eine größere Einheit im Roman, die mehrere Szenen bündeln kann und für Leser:innen Orientierung und Lesepausen schafft. Es ist weniger ein dramaturgisches Werkzeug als ein Lese- und Strukturwerkzeug – die Kapiteleinteilung hilft, den Text in sinnvolle Abschnitte zu gliedern, Spannung zu steuern und den Lesefluss zu rhythmisieren.
Im Gegensatz zur Szene, die die kleinste erzählerische Einheit bildet und in der immer eine konkrete Veränderung stattfindet, ist das Kapitel eine äußere Form, die Szenen zu einem inhaltlichen oder emotionalen Abschnitt zusammenfasst. Eine Szene ist also die dramaturgische Basis, das Kapitel der Rahmen für die Leseführung. Ein Kapitel kann aus einer einzigen Szene bestehen – etwa in actionreichen Thrillern – oder mehrere Szenen enthalten, die thematisch oder atmosphärisch zusammengehören, wie in Familien- oder Entwicklungsromanen.
Klappentext
Der Verkaufstext auf der Rückseite deines Romans – direkt nach Titel und Cover das wichtigste Element, um Leser:innen zum Kauf zu bewegen. Er funktioniert wie ein verlängerter Pitch: In wenigen Absätzen muss er neugierig machen, Emotionen wecken und klar vermitteln, worum es im Buch geht – ohne zu viel zu verraten. Ein guter Klappentext macht ein Versprechen, das der Roman später einlösen muss: Er zeigt Ton, Thema und Genre und lässt Leser:innen spüren, welche Art von Leseerlebnis sie erwartet.
Inhaltlich gehört hinein: die Hauptfigur mit ihrem Ziel oder Konflikt, das zentrale Problem oder Dilemma, ein Spannungsmoment oder emotionaler Haken und am Ende ein offener Bogen, der zum Weiterlesen anregt. Schreibe den Klappentext möglichst konkret und verzichte auf Floskeln („das Leben der Figur wird aus den Angeln gehoben“) und Allgemeinplätze, die nichts aussagen. (Hier findest du noch mehr Infos zu diesem Thema und weitere Tipps rund um die Veröffentlichung im Selfpublishing)
Konflikt
Entsteht, wenn deine Figur etwas will, es aber nicht sofort erreicht, weil ihr etwas im Weg steht. Das kann ein anderer Mensch sein (zwischenmenschlicher Konflikt), die Gesellschaft, ein Naturereignis (äußerer Konflikt) oder auch die Figur selbst (innerer Konflikt). Wichtig ist: Zwei Kräfte ziehen in entgegengesetzte Richtungen – und sorgen so für Spannung, Entscheidungen, Veränderung. Verwechsele Konflikt nicht mit Streit – die meisten Konflikte im Roman haben damit nichts zu tun.
Natürlich kann es auch Streit oder Diskussionen in deiner Geschichte geben, aber ein Romankonflikt kann auch passieren, wenn deine Figur allein ist. Wenn sie zum Beispiel in der Wüste gegen das Verdursten kämpft (Ziel), aber am einzigen Wasserloch weit und breit gerade eine Löwenfamilie campiert (Hindernis, dass dem Ziel Überleben im Weg steht).
Im echten Leben wollen wir Konflikte vermeiden, aber im Roman sollten sich zwingend viele Konflikte aneinanderreihen. Denn sonst entsteht keine Spannung und deine Leserschaft wird dein Buch öde und langweilig finden. Ein Konflikt wird dadurch spannend, dass er die Figur zwingt zu handeln oder sich zu entscheiden. Außerdem sollte er emotional aufgeladen und nicht sofort lösbar sein und Konsequenzen für das Leben der Figur haben.
Midpoint
Markiert die Mitte eines Romans – nicht nur strukturell, sondern vor allem dramaturgisch, zum Beispiel im Drei-Akt-Modell oder der Heldenreise. Er ist ein Wendepunkt, der den Verlauf der Handlung spürbar verändert, sowohl auf der inneren als auch der äußeren Ebene. Typisch für den Midpoint ist, dass die Hauptfigur eine wichtige Erkenntnis gewinnt, einen ersten Erfolg feiert oder eine größere Wahrheit entdeckt – und dadurch aktiver ins Geschehen eingreift. Die Figur wechselt vom Reagieren- in den Agieren-Modus.
Typisch für den Midpoint ist eine Intensivierung: Gefühle wie Liebe, Angst, Wut oder Verzweiflung erreichen hier oft einen Höhepunkt. Gleichzeitig können sich Machtverhältnisse verschieben – etwa durch eine Offenbarung, einen Verrat, einen Etappensieg oder eine herbe Niederlage. Auch das Verhältnis zum Antagonisten wird meist neu definiert. Die Figur bekommt erstmals eine Ahnung davon, worum es auf einer tieferen Ebene wirklich geht – emotional, thematisch oder moralisch.
Im Liebesroman zum Beispiel können sich im Midpoint zwei Figuren ihre Gefühle getehen – doch ab da wird es erst richtig kompliziert. Im Thriller wird dem Ermittler an dieser Stelle klar, wer hinter allem steckt – doch das stellt alles auf den Kopf. Wichtig ist, dass der Midpoint eine klare, neue Richtung einleitet und den inneren und äußeren Konflikt vertieft.
Pinchpoint
Einer von zwei Punkten im zweiten Akt eines Romans, wo die Hauptfigur von den antagonistischen Kräften „gekniffen“ wird. Es passiert etwas, das zeigt, wie stark die gegnerischen Kräfte sind. Im zweiten Akt, der der längste und auch der schwierigste Teil der Geschichte ist, haben viele Schreibende Probleme, die Spannung zu halten. Damit das besser klappt, kann man mit zwei Pinchpoints arbeiten. Der erste Pinchpoint ist oft vor dem Midpoint zu finden, der zweite Pinchpoint danach. Die Hindernisse für die Hauptfigur werden größer, die Gegenspieler mächtiger, die Ziele schwerer erreichbar. Wichtig ist, dass es hier eine Steigerung gibt, denn alles läuft im zweiten Akt auf den „All-is-lost-Moment“ hinaus.
Plot
Die logische Kette von Ereignissen, die dafür sorgt, dass sich deine Hauptfigur verändert. Die Dinge passieren also nicht „irgendwie“, sondern ergeben sich eines aus dem Anderen. Dass sich Konflikte aufbauen und auflösen, dass Spannung entsteht – und dass am Ende ein Gefühl von „Ah, ja – das macht Sinn!“ Viele verwechseln „Plot“ mit „Handlung“. Aber das ist für mich nicht dasselbe. Handlung ist, was passiert. Plot ist, warum es passiert. Ein Beispiel:
- Weil die Figur etwas verliert, deshalb trifft sie eine riskante Entscheidung.
- Weil diese Entscheidung Folgen hat, dadurch verschärft sich der Konflikt.
Plot ist Kausalität. Ursache und Wirkung. Wenn eine Szene nichts verändert, ist sie Deko – kein Plot. Ein funktionierender Plot ist wie ein Dominoeffekt: Jede Entscheidung kippt die nächste an. (Hier findest du noch mehr Infos zu diesem Thema)
Plotpoint
Ein entscheidender Wendepunkt in der Handlung, der den Verlauf der Geschichte in eine neue Richtung lenkt. Er sorgt dafür, dass sich etwas Grundlegendes verändert – im äußeren Geschehen, in der inneren Haltung der Figur oder in beidem. Plotpoints sind keine zufälligen Ereignisse, sondern logische Konsequenzen aus dem bisherigen Handlungsverlauf. Sie zwingen die Figur, neu zu handeln, ihre Strategie zu ändern oder eine Entscheidung zu treffen, die den weiteren Verlauf bestimmt.
Daneben können auch kleinere Wendepunkte innerhalb der Akte auftreten – sie halten die Spannung lebendig und treiben die Handlung voran. Bedenke beim Schreiben, dass ein Plotpoint nur dann stark wirkt, wenn er eine echte Konsequenz hat. Er sollte das Ziel, den Konflikt oder das Selbstverständnis der Figur nachhaltig verändern – nicht bloß etwas „Aufregendes“ passieren lassen.
Protagonist
Die zentrale Hauptfigur deines Romans – die Person, deren Weg, Entscheidungen und Entwicklung im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Er oder sie hat das stärkste Ziel, die größte Fallhöhe, den wichtigsten inneren Konflikt und durchläuft die tiefgreifendste Wandlung. Damit trägt der Protagonist die dramaturgische Hauptlast der Handlung.
Die Hauptfigur ist nicht bloß Beobachter:in – sie agiert aktiv, trifft Entscheidungen, stößt Entwicklungen an oder wird durch sie gezwungen, sich zu verändern. Ohne den Protagonisten gäbe es keine Geschichte, denn sein Zielkonflikt ist das Herzstück der Handlung. Dabei geht es nicht nur um äußere Ziele (z. B. ein Rennen gewinnen oder ein Rätsel lösen), sondern auch um innere Bedürfnisse und emotionale Transformation.
Ein Roman kann auch mehrere Protagonist:innen haben (z. B. in multiperspektivischen Erzählformen), doch jede von ihnen braucht eine eigene Wandlung und ein klares Ziel, damit sie tragfähig bleibt. Entscheidend ist: Die Hauptfigur ist immer diejenige Figur, mit der die Leser:innen sich am stärksten identifizieren sollen – auch wenn sie nicht immer sympathisch sein muss.
Szene
Die kleinste dramaturgische Einheit eines Romans – sie bildet den unmittelbaren Handlungsmoment ab, so wie im Theater oder Film. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Dramentheorie: Eine Szene zeigt einen konkreten Ort, eine bestimmte Zeitspanne und eine Handlung, die sich im Jetzt entfaltet. In einer guten Szene passiert immer eine erkennbare Veränderung – emotional, situativ oder in der Beziehung zwischen Figuren. Am Ende sollte etwas anders sein als am Anfang, selbst wenn es nur eine kleine Verschiebung ist: ein Entschluss, ein neuer Konflikt, eine Erkenntnis.
Eine gelungene Szene hat klare Merkmale:
- Ort und Zeit sind sofort erfassbar.
- Figuren handeln oder reagieren – es wird nicht nur geredet oder erklärt.
- Ein Konflikt oder Ziel treibt das Geschehen an.
- Emotion und Dynamik sind spürbar.
- Am Ende steht eine Folge oder Entscheidung, die in die nächste Szene überleitet.
Jede Szene muss eine Funktion für den Roman erfüllen – sie soll etwas für die Handlung, die Figurenentwicklung oder die Spannung leisten. Szenen, die nur Stimmung erzeugen, ohne etwas zu bewegen, wirken wie Dekoration. Frag dich nach jeder Szene: Was hat sich hier verändert – und warum ist dieser Moment erzählerisch nötig? Wenn du darauf keine Antwort findest, kann die Szene meist gestrichen oder zusammengelegt werden.
Show, don’t tell
Ein zentrales Prinzip im kreativen Schreiben, was wörtlich bedeutet: „Zeigen, nicht behaupten.“ Statt Gefühle, Stimmungen oder Eigenschaften einer Figur direkt zu benennen oder zu behaupten (Tell), kannst du sie durch Verhalten, Sinneseindrücke, Gedanken oder symbolische Handlungen sichtbar machen (show). Wenn du also sagen möchtest, dass eine Figur traurig ist, dann versuche, das Nennen des Adjektivs zu vermeiden und zeige stattdessen das Verhalten der Figur, das ihre Traurigkeit ausdrückt. Zum Beispiel: Tränen schossen ihr in die Augen und die krampfte ihre Hand in den Stoff ihres Kleides.
Das Ziel ist, Leser:innen stärker emotional einzubinden und ihnen Raum zur Interpretation zu geben. Show schafft Nähe, wirkt lebendiger und lässt Figuren authentischer erscheinen. Tell ist dennoch ein wichtiges stilistisches Mittel. Es eignet sich besonders für Zeitsprünge und Übergänge, Informationen, die nicht szenisch entfaltet werden müssen, Bewertungen oder Zusammenfassungen und ein gezieltes Erzähltempo. Ein ausgewogenes Verhältnis von Show und Tell ist meiner Ansicht nach entscheidend für einen gut lesbaren, spannungsvollen und stimmungsvollen Text. Während Show in Schlüsselszenen und emotionalen Momenten dominiert, hilft Tell dabei, den Überblick zu behalten und narrative Bögen zu straffen.
Subplot
Eine Nebenhandlung, die parallel zur Hauptgeschichte verläuft und sie inhaltlich, emotional oder thematisch ergänzt. Er hat in der Regel eine eigene kleine Geschichte – mit Anfang, Mittelteil, Wendepunkt und Auflösung – steht aber immer in direktem Bezug zur Perspektivfigur, aus deren Sicht du deinen Roman schreibst. Das bedeutet: Auch wenn andere Figuren beteiligt sind, muss der Subplot die Hauptfigur betreffen oder beeinflussen.
Ein guter Subplot spiegelt oder kontrastiert zentrale Themen der Haupthandlung, vertieft Figurenbeziehungen, verändert die innere Haltung oder Motivation der Perspektivfigur oder bereitet wichtige Wendepunkte in der Hauptstory vor. In einem Thriller kann ein Liebes-Subplot zum Beispiel die Verletzlichkeit der Heldin zeigen – und sie später in Gefahr bringen. In einem Entwicklungsroman kann durch einen Familienkonflikt (Subplot) der Selbstfindungsprozess der Hauptfigur beschleunigt werden.
Aber vorsicht: Ein Subplot sollte nicht zu früh und nicht zu spät starten. Ideal ist ein Einstieg nach dem ersten Wendepunkt, wenn die Haupthandlung etabliert ist. Der Höhepunkt des Subplots liegt meist rund um den Midpoint der Geschichte. Spätestens vor dem Finale sollte der Subplot aufgelöst werden oder emotional nachhallen, sodass die Aufmerksamkeit am Ende wieder ganz auf der Hauptgeschichte liegt.
Die 12 wichtigsten Bausteine für einen starken Plot
Mehr Struktur,
mehr Spannung,
mehr Storymagie
Strukturiere deinen Roman wie ein Profi!
Dieses kostenlose Freebie hilft dir dabei, Struktur und emotionale Tiefe in dein Romanprojekt zu bringen. Perfekt fürs Plotten und Überarbeiten – mit Leitfragen, Beispielen und Aha-Momenten.


Book, book, hurra! Das ist mein Motto als zertifizierte Lektorin, Schreibcoach und Romanautorin. Ich bin davon überzeugt, dass gute Bücher die Welt ein Stückchen besser machen. Deshalb kann es nicht genug davon geben! Seit 2021 helfe ich Autor:innen mit Empathie und Leichtigkeit dabei, Romane zu schreiben, die berühren, mitreißen und im Gedächtnis bleiben. Denn ich möchte, dass noch mehr tolle Geschichten den Weg hinaus aus den Schubladen zu den Menschen finden, glücklich machen und den Alltag vergessen lassen. Wenn ich nicht lektoriere oder coache, schreibe ich selbst Romane und Kurzgeschichten, die von Familienbanden und Freundschaften erzählen, die Geheimnisse und Lügen entlarven und wo Liebe alles verändern kann.
Meine Romane & Kurzgeschichten findest du hier.
Mehr über mich erfährst du hier