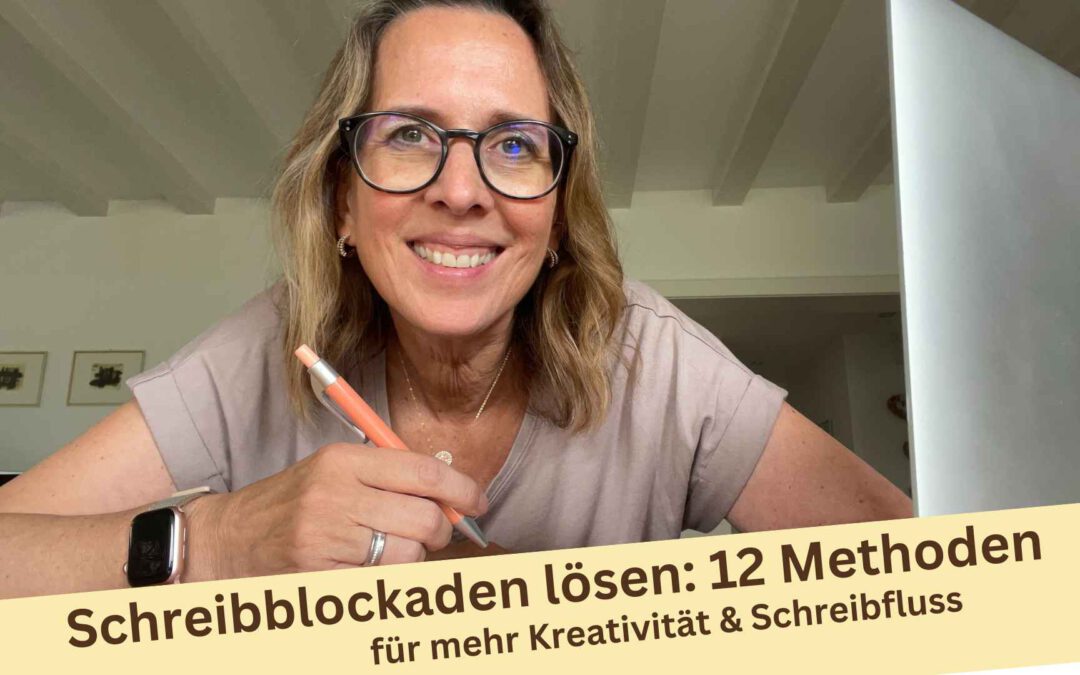Kennst du das auch? Es gibt diese Tage, da starrst du auf den Bildschirm und nichts passiert. Der Cursor blinkt wie ein trotziges Kind, das sagt: „Na los, schreib schon!“ Doch in deinem Kopf herrscht Funkstille. So als hätte jemand alle Wörter gelöscht. Aber keine Sorge – so eine Schreibblockade ist kein Zeichen von Scheitern, sondern ein völlig normaler Teil des kreativen Prozesses. Dein Kopf, dein Herz oder dein Text brauchen mal etwas anderes. Was genau? Das findest du mit den richtigen Impulsen heraus.
Schreibe absichtlich schlecht
Setz dich hin und schreib den schlechtesten Rohentwurf ever. Oder, wenn du an einer bestimmten Stelle im Roman hängst, die kitschigste Liebesszene des Universums. So, dass der Deutschlehrer aus der 9. Klasse rot anlaufen würde. So schlecht, dass dein innerer Kritiker die Augen verdreht und sagt: „Okay, das war’s. Ich kündige.“ Das ist ein Tipp, den ich in meinen Coachings oft gebe. Warum? Weil genau da die Magie beginnt, wenn du von einer neuen Seite draufschaust.
Denn der größte Kreativitätskiller ist: Dein Perfektionismus. Der kleine, nervige Typ im Kopf, der dir ständig zuflüstert: „Das ist nicht gut genug. Das liest keiner. Du blamierst dich.“ Und was machst du, wenn du diesen Typen mal so richtig auflaufen lassen willst? Ja, genau: Du gibst ihm das Gegenteil von dem, was er verlangt: Müll. Unsinn. Kitsch. Chaos. Und dabei lachst du – weil du die Kontrolle übernimmst. Psychologisch betrachtet schaltest du dabei die ständige Selbstzensur aus. Du entkoppelst das kreative Schreiben vom inneren Qualitätsanspruch. Und genau dadurch entsteht ein mentaler Freiraum, in dem sich neue, ungefilterte Gedanken zeigen können.
Setze dir dabei ein klares Ziel, lass es krachen und erlaube dir zu lachen. Humor kann ganz viel Spannung lösen. Und wenn du lachst, fließt der Text plötzlich wieder. Absichtlich schlecht zu schreiben ist wie mentales Stretching. Es nimmt den Druck raus. Es zeigt dir, dass nichts Schlimmes passiert, wenn du mal richtig daneben liegst. Und: Oft entsteht genau daraus das Gegenteil – echte, überraschende Qualität. Denn manchmal musst du durch den Blödsinn graben, um das Gold zu finden. Also: Mach dich frei und genieße es. Du darfst. Du sollst. Du musst. Denn vielleicht wartet genau dort, zwischen dem literarischen Lasagne-Vergleich und der feurigen Fee aus Funkelhausen, deine nächste geniale Idee.
Du bist beim Schreiben deines Romans steckengeblieben und versinkst in Frust und Selbstzweifeln? Du wünscht dir einen professionellen Motivationsschubser um wieder in den Schreibfluss zu kommen? In einem Coachinggespräch lösen wir gemeinsam deine Knoten. Ich freue mich auf dich!
Ortswechsel = Perspektivwechsel
Wenn du eine Schreibblockade hast und der Text nicht fließt, liegt’s vielleicht nicht an dir – sondern an deinem Schreibtisch. Ja, genau: diesem treuen, aber manchmal öden Möbelstück, das dich mit seinem Karma erdrücken kann wie ein dröger Romananfang. So geht es mir manchmal auch – vor allem, wenn sich die Notizzettel mal wieder stapeln.
Was du brauchst? Einen Tapetenwechsel. Oder zumindest einen anderen Blickwinkel. Denn dein Umfeld hat mehr Einfluss auf deinen Schreibfluss, als du denkst. Unser Gehirn liebt neue Reize. Es scannt ständig die Umgebung, sucht Muster, Geräusche, Gerüche. Wenn du immer am selben Ort schreibst – mit denselben Tassenringen auf dem Tisch, demselben Blick auf den Wäschekorb – passiert: nichts Neues. Doch wenn du die Szenerie wechselst, passiert Unerwartetes:
🔸 Andere Umgebung = andere Gedanken.
🔸 Ungewohnte Geräusche, Gerüche, Menschen = kreative Impulse.
🔸 Bewegung = mehr Sauerstoff = mehr Gehirnenergie.
Kurz gesagt: Wenn du die Umgebung änderst, änderst du deine Wahrnehmung. Und mit ihr deinen Text. Ortswechsel wirken wie ein „Reboot“ für dein Gehirn. Du durchbrichst eingefahrene Denkpfade und wirst wieder flexibler, neue Lösungen zu finden. Ein Ortswechsel erzwingt diese Flexibilität – sanft, aber effektiv. Und plötzlich fällt dir ein, was du deiner Hauptfigur eigentlich schon drei Kapitel früher sagen lassen wolltest. Sobald du merkst, dass es wieder fließt, kannst du auch zurück an deinen Schreibtisch. Aber diesmal mit frischer Energie, einem neuen Gefühl für deine Geschichte – und vielleicht dem besten Absatz seit Wochen.
Schreib mal woanders – und schau, was das mit dir macht:
Im Café: Das Murmeln anderer Gäste wirkt wie weißes Rauschen. Du bist umgeben von Menschen, aber niemand stört dich. Und plötzlich tippt es sich wie von selbst.
Auf dem Balkon: Die Sonne auf der Haut, ein Vogel zwitschert, der Wind spielt mit deinen Seiten – und deine Hauptfigur bekommt endlich die Szene, die sie verdient.
Im Park: Ein Baum wird zur Inspiration, ein fremdes Gespräch auf der Parkbank nebenan zum Plot Twist.
In der Küche: Warum nicht? Der Duft von Kaffee, das leise Surren des Kühlschranks – und zack, du schreibst einen Dialog, der nach Zuhause riecht.
Im Bett: Die Kuscheldecke, das Kissen im Rücken – du tippst dich in intime Szenen mit genau der Zartheit, die vorher gefehlt hat.
Schreiben mit der Hand
Wenn du eine Schreibblockade hast: Mach mal Pause vom Tippen. Schieb den Laptop beiseite. Und nimmt Stift und Papier in die Hand. Oder ein schönes Notizbuch. Analoges Schreiben ist eine total unterschätzte Kreativitätsrakete. Denn beim handschriftlichen Schreiben passiert etwas Faszinierendes: Du verlangsamst. Nicht im Sinne von träge, sondern im besten Sinne von: achtsam. Du schreibst Wort für Wort, mit deiner ganzen Hand, deinem ganzen Körper. Jeder Buchstabe wird zu einer kleinen bewussten Entscheidung und eine Einladung zum Fühlen, Spüren und Denken.
Warum hilft es gegen Schreibblockaden?
🔸 Weil langsames Schreiben dein Gehirn auf Empfang stellt.
🔸 Weil du dich beim Kritzeln auf den Kern deiner Gedanken konzentrierst.
🔸 Weil du beim handschriftlichen Schreiben keine Tabs öffnen, keine E-Mails checken, keine Emojis einfügen kannst.
Kurz gesagt: Du reduzierst Ablenkung und schaffst Verbindung – zu dir, zu deinem Text, zu deiner Geschichte. Denn du aktivierst dabei andere Hirnareale als beim Tippen: Motorik, Emotionalität, visuelles Zentrum. Das fördert vernetztes Denken und emotionale Tiefe. Kein Wunder, dass viele ihre handgeschriebenen Texte „echter“ finden. Das hast du bestimmt auch schon mal gespürt, oder?
Erzähle es laut
Kennst du das? Du bist festgefahren in deinem Plot, deine Figuren wirken blass, und du weißt plötzlich nicht mehr: Worum geht’s hier eigentlich nochmal? Dann mach Folgendes: Stell dir vor, du sitzt mit deiner besten Freundin beim Kaffee. Und sie fragt dich: „Worum geht’s in deinem Buch?“ Erzähl es ihr. Laut. Frei. Ohne zu schreiben. Ohne nachzudenken. Einfach so, wie du es eben sagen würdest.
Laut reden denkt anders: Sobald du über deinen Text sprichst, verlässt du die Kopfverknotung und kommst in einen natürlichen Erzählfluss. Deine Gedanken sortieren sich beim Reden – nicht vorher.
Sobald wir etwas laut aussprechen, gewinnen wir Abstand – und dadurch Klarheit.
Du merkst, wo du stockst. Wo du plötzlich begeistert wirst. Und wo du sagst: „Also… äh… dann passiert irgendwas mit einem Schlüssel oder so.“ Zack – genau da fehlt noch Substanz. Und du hast es selbst erkannt, ganz ohne Ratgeber oder Schneeflockenmethode.
Wenn deine Freundin gerade keine Zeit hat, dann sprich mit deinem Handy und nimm dich dabei auf. Erzähl frei drauflos, als würdest du jemandem den wichtigsten Roman deiner Karriere pitchen. Oder erzähl es deinem Haustier. Deiner Zimmerpflanze. Deinem Spiegelbild. Es geht nicht um Feedback. Es geht um deine eigene Klarheit.
Achte dabei auf deine Betonung. Wo wirst du lebendig? Wo sprichst du schnell? Wo wirst du leise?
Diese Stellen verraten dir, wo das emotionale Herz deiner Geschichte schlägt. Und das ist Gold wert für deine nächste Szene.
Freewriting: Schreib dich frei
Freewriting (oder Freischreiben oder assoziatives Schreiben) ist eins meiner Lieblingswerkzeuge, wenn es mal hakt. Stell dir vor, dein Kopf ist wie ein vollgestopfter Dachboden. Überall liegen Ideen, angefangene Sätze, halbe Dialoge, Sorgen, Einkaufslisten, Liedzeilen von 2002 – ein kreatives Chaos. Und du willst mitten in diesem Wust einen funkelnden, wohlgeformten Romanabsatz erschaffen? Keine Chance. Was du dann brauchst, ist ein Staubsauger für den Kopf. Oder besser: ein literarischer Laubbläser. Genau das ist Freischreiben (oder Freewriting oder assoziatives Schreiben)
Es bedeutet, dass du für eine festgelegte Zeit – sagen wir 5, 10 oder 15 Minuten – einfach losschreibst, am besten mit Papier und Stift. Ohne Pause. Ohne nachzudenken und den Stift abzusetzen. Ohne Punkt und Komma. Das ist wie kreatives Joggen ohne Streckenplan. Du schreibst, was dir in diesem Moment durch den Kopf geht – völlig egal, ob es zusammenhängend, sinnvoll oder brillant ist. Egal, welches Thema.
Wichtig:
🔸 Du darfst dich nicht korrigieren.
🔸 Du darfst dich nicht bewerten.
🔸 Du darfst nicht aufhören, auch wenn du nur schreibst: „Ich weiß nicht, was ich schreiben soll…“ oder „blablabla“
Warum funktioniert das so gut?
Damit kannst du einen inneren Kritiker austricksen, der ständig flüstert: „Das ist nicht gut genug. Das kannst du besser. Was sollen die Leute denken?“ Beim Freischreiben geht’s nicht um „gut“. Es geht um loslassen. Und das hat erstaunliche Effekte:
🔸 Du lockerst deine Gedanken.
🔸 Du bringst unterschwellige Themen an die Oberfläche.
🔸 Du setzt den Schreibfluss in Gang – und genau darum geht’s.
Psychologisch gesehen, schaltest du vom „bewertenden Denken“ in den „assoziativen Modus“ um. Du erlaubst deinem Gehirn, zu spielen. Und aus genau diesem Spiel entstehen oft die besten Ideen. Freischreiben kannst du übrigens auch zu bestimmten Themen, zum Beispiel, wenn du in einer Szene feststeckst oder beim Plotten einen Knoten im Hirn hast. Dann nimm genau diesen Punkt und schreibe dich „frei“.
Wenn du’s noch nie ausprobiert hast: Tu es. Jetzt. Für fünf Minuten. Du wirst überrascht sein, was da alles in deinem Kopf herumflattert, das nur auf einen kleinen, mutigen „Schreib-es-einfach“-Moment gewartet hat. Schreiben ist kein heiliges Ritual. Es ist lebendig, wild, manchmal chaotisch – und oft beginnt es genau da, wo du dich traust, nicht perfekt zu sein.
Deine 5-Minuten-Freewriting-Challenge:
🔸 Stell dir einen Timer auf 5 Minuten und nimm dir ein Blatt Papier und deinen Lieblingsstift
🔸 Nimm dir dein Thema oder beginne einfach mit dem Satz „Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber…“
🔸 Schreib ohne Unterbrechung. Keine Pausen, kein Nachdenken.
🔸 Lies es nicht sofort durch. Erst mal nur machen.
🔸 Wiederhole das gern täglich – als Warm-up oder Notfallhilfe bei Schreibblockaden.
Schreibimpulse nutzen
Kennst du diese Momente, in denen du dringend schreiben willst – aber dein Gehirn guckt dich nur fragend an? Ein Schreibimpuls ist eine kleine kreative Provokation. Ein Startsignal. Ein „Was wäre, wenn …?“ für dein Gehirn. Er ist nicht dazu da, perfekte Texte hervorzubringen – sondern um deinen Denkraum zu öffnen. Und genau darum funktioniert er so gut, wenn du festhängst.
Schreibblockaden entstehen oft dann, wenn du zu viel Kontrolle willst (oder du in deinem Plot an einer Stelle hängenbleibst, die noch nicht funktioniert). Oder wenn du zu sehr „richtig“ schreiben willst. Ein Schreibimpuls dagegen nimmt dir die Entscheidung ab. Du denkst nicht lange nach. Du schreibst einfach. Und dabei – ganz nebenbei – trainierst du:
🔸 Assoziatives Denken
🔸 Sprachfluss
🔸 Figurenentwicklung
🔸 Kreative Freiheit
Variante 1: Der Zufallssatz aus einem Buch
Greif zu einem Roman, schlag irgendeine Seite auf, und nimm den ersten vollständigen Satz, den du siehst. Beispiel: „Ich wusste, dass ich nicht hätte zurückkehren dürfen.“ Schreib jetzt eine Szene, in der jemand genau das denkt. Wer ist es? Wo ist er oder sie? Was passiert gerade? Alles darf entstehen.
Variante 2: Das Bild-Experiment
Such dir online ein ungewöhnliches Bild (zum Beispiel bei Pinterest, Instagram). Vielleicht ein verlassener Jahrmarkt, ein rostiger Schlüssel, ein Kind im Regen. Schau es dir an – und schreib: Wer ist da? Was ist geschehen? Warum wirkt das Bild auf dich so?
Variante 3: Eine Schlagzeile als Szenenstart
Geh auf eine Nachrichten-Website und schnapp dir eine skurrile oder geheimnisvolle Überschrift.
Beispiel: „Mann findet in Gartenmauer eine verschlossene Metallkiste.“ Schreib dazu eine Szene – vielleicht Thriller, vielleicht Komödie.
Schreibimpulse sind ein Spielplatz für deinen Schreibmuskel. Das Geniale daran: Es gibt kein Richtig oder Falsch. Keine „Handlung“, die stimmen muss. Du darfst übertreiben, fantasieren, ins Absurde gehen. Und genau in diesem Raum entstehen oft neue Ideen, die später in deinen echten Text einfließen. Inspiration wartet überall, du musst sie nur anstupsen.
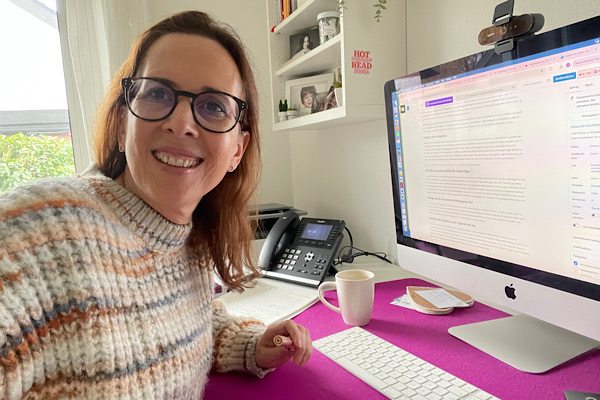
Bewegung als Ideen-Booster
Es gibt diesen Moment: Du starrst auf den Bildschirm, deine Gedanken drehen sich im Kreis, deine Figur will nicht aus dem Auto steigen, dein Plot hängt fest wie ein labbriger Pfannkuchen an der Decke. Und dann sagt dein Körper (ganz leise, aber bestimmt): „Hey… was, wenn wir einfach mal aufstehen?“
Gute Idee. Richtig gute Idee. Denn Bewegung ist nicht nur gut für den Rücken – sie ist Anschubenergie für deine Kreativität. Wenn du dich bewegst – egal ob beim Spazierengehen, Yoga, Fahrradfahren oder Wohnzimmer-Tanzen – passiert in deinem Gehirn Folgendes:
🔸 Der Blutfluss steigt, du bekommst mehr Sauerstoff ins Hirn.
🔸 Der Cortisolspiegel (aka Stresshormon) sinkt.
🔸 Bewegung macht den Kopf frei – und Platz für neue Gedanken.
Drei Bewegungs-Magie-Momente für Schreibende:
Der Spaziergang mit Notiz-App
Geh raus, ohne Ziel. Hör dem Sausen des Windes oder dem Zwitschern der Vögel zu. Beobachte, wie die Nachbarskatze eine Taube jagt. Und lass die Gedanken kommen. Ich hab das selbst schon so oft ausprobiert und dann war da plötzlich eine Dialogzeile, eine Idee für einen Plottwist oder für eine interessante Nebenfigur. Dann spreche ich es mir schnell aufs Handy oder schreibe es in mein Notizbuch, das ich meistens dabei habe. Wichtig ist, die Geistesblitze direkt irgendwo festzuhalten, denn manchmal sind gute Ideen so flüchtig wie der Wind und nach ein paar Minuten kannst du dich nicht mehr an sie erinnern.
Yoga mit Schreibschlussfolgerung
Nach dem letzten herabschauenden Hund merkst du plötzlich: Deine Figur hat nie wirklich losgelassen. Und das ist genau das, was du in der nächsten Szene erzählen wirst.
Tanze die Blockade weg
Mein Lieblings-Hack, vor allem, wen ich alleine zu Hause bin. Schalte Musik an und tanze. Völlig egal wie. Lass deinen Körper das ausdrücken, was dein Kopf nicht fassen kann. Es wirkt. Es befreit. Und es bringt dich oft in eine ganz andere, tieferliegende Verbindung mit deinem Text. Und es pustet dein Hirn wieder frei, denn du bewegst dich und hörst gleichzeitig deine Lieblingsmusik. Das setzt jede Menge Glückshormone frei.
Viele Blockaden beim Schreiben entstehen, wenn du dich von deinem Text entkoppelt fühlst – als würde da jemand schreiben, der dich nur halb kennt. Bewegung bringt dich zurück: zu deinem Körper, deinem Gefühl, deinem Rhythmus. Und genau da – genau dort, zwischen zwei Schritten oder beim Ausatmen – kommt oft die Erkenntnis, die du stundenlang am Schreibtisch vergeblich gesucht hast.
Musik-Matching: Soundtrack für deinen Flow
Manche Szenen brauchen Drama. Manche brauchen Herzschmerz. Manche brauchen … Paukenschläge. Musik kann wahre Wunder bewirken! Denn Schreiben ist nicht nur Kopf – es ist auch Gefühl. Und Gefühle lassen sich mit Musik wecken wie schlafende Drachen. Du musst nur wissen, welchen Soundtrack du ihnen vorspielst.
Du erstellst dir eine Playlist, die genau zur Stimmung passt, die du gerade schreiben willst. Oder: Du suchst gezielt nach Musik, die dich in einen bestimmten emotionalen Zustand versetzt. Zum Beispiel melancholische Klaviermusik für den Abschied. Epische Orchesterklänge für den Showdown. Synthiepop für die chaotische Teenie-Szene. Akustikgitarren für zarte Nähe. Alles erlaubt – solange es dich fühlen lässt.
Als ich meinen Roman „Leuchtturm der vergessenen Wünsche“ geschrieben habe, hat für mich am besten instrumentale Filmmusik (zum Beispiel von Hans Zimmer) oder Klaviermusik von Yiruma funktioniert, um mich in eine bestimmte zu versetzen und mir die Szene, die ich gerade schreiben wollte, gut vorstellen zu können. Ich kann allerdings nur mit Instrumentalmusik schreiben, es darf niemand singen! Sonst höre ich dem Text zu und kann nichts eigenes schreiben. Was auch super ist: Wald- oder Regengeräusche. Und natürlich Meeresrauschen! Auf YouTube oder Spotify findest du dazu ganz viele verschiedene Sammlungen dazu.
Warum das mit Musik so gut klappt? Sie direkt ins limbische System geht – also in das Zentrum deiner Emotionen. Ohne Umweg über den Verstand. Ohne Analyse. Einfach zack – Gefühl. Und genau das brauchst du beim Schreiben. Denn je mehr du dich mit der Emotion deiner Szene verbindest, desto authentischer wird sie. Du fühlst die Stimmung – und das überträgt sich fast automatisch auf deine Worte.
Manchmal funktioniert’s sogar umgekehrt: Du hörst einen Song – und daraus entsteht eine Szene. Vielleicht sogar eine ganze Geschichte. Der Beat wird zu einem Fußschritt. Der Refrain zu einem Wendepunkt. Die Pause vor dem Drop zu einem stillen Blick zwischen zwei Figuren.
Szenen-Puzzle: Aus der Mitte schreiben
Wer sagt eigentlich, dass du bei Kapitel eins anfangen musst zu schreiben? Niemand, oder? Manchmal ist der lineare, direkte Weg nicht der, der für dich am besten funktioniert. Ich gebe dir also hiermit offiziell die Erlaubnis, hinten anzufangen, oder in der Mitte. Oder in der einen besonderen Szene, in der deine Hauptfigur das erste Mal dem Mörder gegenübersteht.
Kreativität tickt nicht immer linear. Sie ist kein Zug, der pünktlich von A nach B fährt. Sie ist eher wie ein Schmetterling mit Kaffeeintoleranz – flatterhaft, wild, aber wunderschön. Wenn du versuchst, sie in eine feste Reihenfolge zu pressen („Ich muss erst den Übergang schreiben“), kann sie zumachen. Aber wenn du ihr gibst, was sie liebt – Emotion, Neugier, Spannung – dann sprudelt sie. Außerdem: Szenen, auf die du dich freust, schreibst du mit mehr Energie, mehr Herz, mehr Flow. Und dieser Flow trägt dich dann oft automatisch zu den Szenen davor und danach.
Du darfst dein Buch wie ein Puzzle schreiben. Dafür brauchst du manchmal nur ein paar Lieblingsstücke – und dann fügen sich andere oft wie von selbst. Und ja: Manchmal liegt ein Teil erst mal daneben, sieht unpassend aus – bis du merkst: Es gehört ganz genau da hin.
Visualisiere deine Szene
Bevor du dich hinsetzt und Wörter auf die Seite haust, mach mal folgendes: Lehn dich zurück und schließe die Augen. Und stell dir deine Szene vor wie einen Film – mit Kamera, Sound, Licht, Detailverliebtheit und allem, was dazugehört. Denn bevor du sie schreibst, darfst du sie erstmal sehen. Fühlen. Hören. Spüren.
Dein Gehirn liebt Bilder. Und sobald du die Szene wie einen Film abspielst, schaltet es in den Modus: „Aha! Das kenne ich. Jetzt kann ich loslegen.“ Außerdem: Emotionale Tiefe lässt sich viel leichter schreiben, wenn du sie vorher schon mal gefühlt hast. Und das passiert beim Visualisieren fast automatisch. Diese bewusst visuelle Herangehensweise hilft dir, viel leichter und stimmungsvoller zu schreiben.
So geht’s – dein kleines Kopfkino-Ritual:
🔸 Nimm dir 2 Minuten Zeit, bevor du schreibst.
🔸 Schließ die Augen und „scanne“ die Szene wie ein Regisseur: Wo spielt sie? (Küche? Überfüllter Bahnhof?) Wer ist da? Wie ist das Licht? Was hörst du? (Ein leises Ticken? Stimmengewirr? Regentropfen, die an die Fensterscheibe prasseln?) Welche Farben, Gerüche, Stimmungen sind da? (Warm? Kalt? Nach Tee und Abschied?)
🔸 Öffne die Augen – und schreib aus dem Bild heraus.
Perspektivwechsel: Figur schreibt Tagebuch
Du willst deine Figur besser verstehen? Mehr über ihre Gedanken, Ängste, Marotten herausfinden? Dann gib ihr einen Stift in die Hand – und lass sie ein fiktives Tagebuch in der Ich-Perspektive schreiben. Nicht, weil du das anschließend für deinen Roman verwenden willst (ist aber natürlich möglich), sondern nur, um mehr über deine Figur zu erfahren, über ihre Gedanken, ihr Innenleben, ihre Ängste, Sehnsüchte und Wünsche. Schreibe also einen Text, der klingt, als hätte deine Figur ihn selbst verfasst. Ob hochreflektiert oder brüllend wütend, ob poetisch oder bockig – alles ist erlaubt.
Warum hilft das bei einer Blockade? Das Zauberwort lautet: Empathie. Sobald du in die Haut deiner Figur schlüpfst und beginnst, wie sie zu denken, passiert im Gehirn etwas Wunderbares: Es werden Spiegelneuronen aktiv. Du fühlst, was sie fühlt. Du entwickelst Mitgefühl – oder Widerstand. Und genau das bringt emotionale Tiefe in deine Geschichte. Außerdem: Du lässt deine Figur mit dir „sprechen“. Und dabei kommen oft Details ans Licht, die im normalen Schreiben verborgen geblieben wären.
Diese Technik hilft auch super, sperrige Nebenfiguren besser kennenzulernen. Lass auch sie mal schreiben – und plötzlich gesteht sie dir vielleicht, dass sie heimlich gegen deine Hauptfigur arbeitet. Oder seit Jahren in sie verliebt ist. Oder einfach nur ein Problem mit Gänsen hat. Und genau daraus entstehen neue Ideen für deinen Roman.
Selbstmitgefühl bei Blockaden
Vielleicht kennst du das auch: Du sitzt da und der Cursor blinkt die vorwurfsvoll an. Du versuchst alles, aber nichts geht. Und dann flüstert diese innere Stimme. „Was stimmt nicht mit mir? Andere schreiben doch auch! Vielleicht bin ich gar keine echte Autor:in…“
Stopp. Erstmal atmen. Schreibblockaden sind keine persönliche Schwäche. Sie sind ein Signal.
Sei milde mit dir – so, wie du auch mit deiner besten Freundin wärst, wenn sie in dieser Klemme stecken würde. Wenn sie dir anvertrauen würde, dass sie nicht mehr kann, würdest du auch nicht sagen: Reiß dich zusammen, oder? Du würdest sie motivieren, ihr ihre Lieblingsschokolade vorbei bringen oder einfach mal in den Arm nehmen.
Beim Schreiben ist das revolutionär. Denn unser innerer Kritiker liebt Druck. Er flüstert: „Du musst jetzt liefern. Wenn du’s nicht tust, bist du gescheitert.“ Kein Wunder, dass dann dein ganzes System blockiert. Selbstmitgefühl wirkt wie ein inneres Rettungsteam, das sagt: „Du darfst scheitern. Du darfst zweifeln. Und du bist trotzdem eine gute Autor:in.“ Kreative Prozesse brauchen keinen Druck – sie brauchen Raum. Und Vertrauen.
Statt also immer zu denken „Ich schaffe das nie. Ich krieg’s einfach nicht hin.“ Sage dir bewusst „es ist okay, dass es heute schwer ist. Ich darf Pausen machen. Ich darf unsicher sein. Und ich schreibe trotzdem weiter – in meinem Tempo.“ Das gilt übrigens nicht nur für Schreibblockaden – sei doch einfach immer ein bisschen milder mit dir und achte darauf, dass du mit dir selbst liebevoll sprichst und dich nicht immer runtermachst.
So geht’s – in 3 kleinen Schritten:
🔸 Statt bewerten – beobachten
Spürst du Frust? Müdigkeit? Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit? Erkenne sie an, ohne sie zu verurteilen.
🔸 Sprich mit dir wie mit einer guten Freundin
Was würdest du jemand anderem sagen, der das gerade durchmacht? Sag es dir selbst. Wirklich. Laut.
🔸Schreib liebevoll
Manchmal reicht ein einziger Satz wie:
„Heute ist nicht mein Tag – und das ist okay.“
Oder: „Ich bin nicht meine Schreibblockade. Ich bin mehr als das.“
Du bist beim Schreiben deines Romans steckengeblieben und versinkst in Frust und Selbstzweifeln? Du wünscht dir einen professionellen Motivationsschubser um wieder in den Schreibfluss zu kommen? In einem Coachinggespräch lösen wir gemeinsam deine Knoten. Ich freue mich auf dich!

Book, book, hurra! Das ist mein Motto als zertifizierte Lektorin, Schreibcoach und Romanautorin. Ich bin davon überzeugt, dass gute Bücher die Welt ein Stückchen besser machen. Deshalb kann es nicht genug davon geben! Seit 2021 helfe ich Autor:innen mit Empathie und Leichtigkeit dabei, Romane zu schreiben, die berühren, mitreißen und im Gedächtnis bleiben. Denn ich möchte, dass noch mehr tolle Geschichten den Weg hinaus aus den Schubladen zu den Menschen finden, glücklich machen und den Alltag vergessen lassen. Wenn ich nicht lektoriere oder coache, schreibe ich selbst Romane und Kurzgeschichten, die von Familienbanden und Freundschaften erzählen, die Geheimnisse und Lügen entlarven und wo Liebe alles verändern kann.
Meine Romane & Kurzgeschichten findest du hier.
Mehr über mich erfährst du hier