Ein „Red Herring“ ist eine erzählerische Technik, die du in Geschichten gezielt einsetzen kannst, um deine Leser:innen in die Irre zu führen. Dabei streust du falsche Hinweise oder irreführende Informationen glaubwürdig in die Handlung ein. Das ist ein super Kniff besonders in Krimis oder Thrillern. Das Ziel dabei ist, die Leser:innen glauben zu lassen, sie hätten die Auflösung eines Rätsels oder die Identität eines Täters herausgefunden, nur um sie später eines Besseren zu belehren. Ein „Red Herring“ ist also ein klassisches Ablenkungsmanöver, das mit den Erwartungen spielt. Paradebeispiele dafür sind Sherlock-Holmes-Geschichten oder die Romane von Agatha Christie.
Woher stammt der Begriff „Red Herring“?
Der Begriff kommt aus der englischen Sprache und bedeutet wörtlich übersetzt „roter Hering“. Eigentlich ist damit ein geräucherter Salzhering gemeint, der sich durch das Räuchern rot verfärbt. In der Bedeutung als falsche Fährte ist „Red Herring“ seit Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig und stammt von der damals weit verbreiteten Annahme, dass man Jagdhunde durch den Geruch der geräucherten Fische auf eine falsche Spur locken könnte. Ob das wirklich funktioniert, war allerdings nicht klar, denn wissenschaftliche Belege gab es dafür nicht.
Den „Red Herring“ kennt man auch in anderen Bereichen als in der Erzähltheorie. In der Politik zum Beispiel wird er eingesetzt, um von kontroversen Entscheidungen abzulenken, indem Unwichtiges in den Vordergrund gerückt wird. In der Rhetorik und Argumentationstheorie meint man damit ein unsachliches Argument, um unliebsame Diskussionsgegner oder das Publikum abzulenken.
Kennst du schon meinen Newsletter? Darin teile ich regelmäßig und exklusiv mit meinen Abonnenten tolle Schreibtipps und Wissenswertes rund um das Thema Lektorat. Neugierig?
Warum ist der „Red Herring“ im Roman wichtig?
Ein „Red Herring“ erzeugt nicht nur Verwirrung, sondern hält auch die Spannung in einer Geschichte aufrecht. Vor allem in Krimis und Thrillern sind es die falschen Fährten, die dafür sorgen, dass Leser:innen aktiv mitdenken und rätseln. Mega, denn genau das wollen sie. Dieses Miträtseln in der Spannungsliteratur gehört zu den klassischen Genreerwartungen. Indem du „Red Herrings“ einbaust, hältst du deine Leserschaft aktiv bei der Stange. Die wahre Auflösung eines Rätsels hat zudem einen viel größeren Effekt, du sie vorher auf eine falsche Spur geführt hast. Und nebenbei sorgst du für überraschende Wendungen und verhinderst, dass dein Plot vorhersehbar wird.
„Red Herrings“ unterstützen auch die Entwicklung der Romanfiguren, denn mit ihrer Hilfe kannst du supergut zeigen, wie sie auf die falschen Hinweise reagieren. Das offenbar ihre Persönlichkeit oder ihre Motivation. Schaffst du es beim Schreiben, Ablenkungsmanöver geschickt einzusetzen, kannst du ziemlich sicher sein, dass deine Geschichte später überraschende „Aaaahs“ oder „Oooohs“ auslöst. Denn sie werden als Teil eines cleveren Plans wahrgenommen.
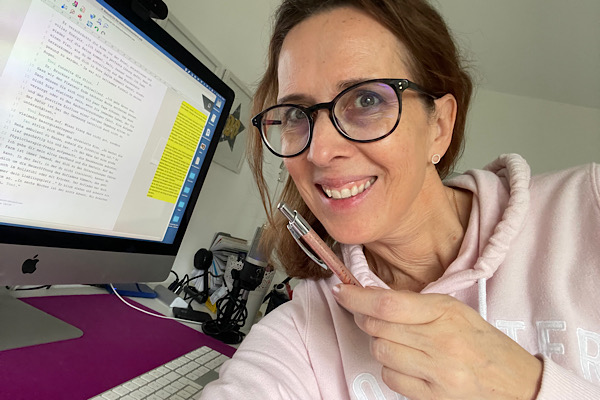
Wie du „Red Herrings“ erfolgreich in deinem Roman einsetzt?
Ein „Red Herring“ ist nur dann wirkungsvoll, wenn du einige wichtige Dinge beachtest.
1. Sei subtil und glaubwürdig
Ein guter „Red Herring“ sollte niemals zu offensichtlich sein. Gib deinen Leser:innen nicht das Gefühl, dass sie absichtlich getäuscht werden. Der Hinweis sollte sich idealerweise wie ein natürlicher Teil der Handlung anfühlen – nicht wie ein plumper Versuch, in die Irre zu führen. Eine Meisterin der falschen Fährten ist die britische Autorin Agatha Christie. In ihrem Roman „Der Mord im Orientexpress“ lenkt sie den Verdacht geschickt auf mehrere Charaktere und streut Hinweise, die plausibel wirken, aber nur dazu dienen, den Leser von der wahren Auflösung abzulenken.
💡 Tipp für deinen Roman
Wenn du falsche Fährten legst, stelle sicher, dass sie nicht wie „Ablenkungen“ wirken. Integriere sie nahtlos in die Handlung, indem du den Leser mit nachvollziehbaren Indizien und plausiblen Motiven in die Irre führst.
2. Prüfe, ob deine „Red Herrings“ zur Story passen
Ein schlechter „Red Herring“ ist ein zufälliges oder unlogisches Detail, das nur eingefügt wurde, um Lesende zu verwirren. Ein guter „Red Herring“ ist hingegen tief in der Handlung verankert und fügt sich glaubwürdig in die Geschichte ein. In „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (Vorsicht: Spoiler!) zum Beispiel glauben Harry und seine Freunde lange Zeit, dass Professor Snape derjenige ist, der hinter dem Versuch steckt, den Stein der Weisen zu stehlen. Alles, von Snapes bedrohlicher Persönlichkeit bis zu seinen verdächtigen Aktionen (zum Beispiel sein Verhalten beim Quidditch-Spiel), lenkt die Aufmerksamkeit auf ihn. Erst am Ende wird enthüllt, wer der wahre Täter ist – eine perfekte Finte, die aus der Handlung heraus entsteht.
💡 Tipp für deinen Roman
Frage dich bei jedem Hinweis, ob er tatsächlich auch so passieren kann. Falsche Fährten sollten durch die Logik der Welt, die du geschaffen hast, unterstützt werden.
3. Gib den Lesern einen Grund, an die falsche Spur zu glauben
Ein „Red Herring“ funktioniert nur, wenn die Leser:innen ihn für wahr halten. Dazu musst du Beweise oder Hinweise so geschickt präsentieren, dass sie glaubwürdig wirken. Das können Verhaltensweisen, Dialoge oder Gegenstände sein, die ein falsches Bild zeichnen. Im Film „Knives Out – Mord ist Familiensache“ (Vorsicht: Spoiler!) wird der Verdacht geschickt auf verschiedene Figuren gelenkt. Schließlich denkt man, dass Pflegerin Marta den Mord aus Versehen begangen hat – vor allem, weil das Drehbuch uns glauben lässt, sie hätte die Medikamente verwechselt. Die wahre Auflösung stellt am Ende jedoch alles auf den Kopf.
💡 Tipp für deinen Roman:
Verwende detaillierte Hinweise, die auf den ersten Blick schlüssig wirken, sich aber dann als etwas Anderes entpuppen.
4. Löse die falsche Fährte auf
Ein „Red Herring“ sollte nie unbeantwortet bleiben. Deine Leser:innen möchten am Ende wissen, warum sie in die Irre geführt wurden – und diese Auflösung sollte sinnvoll und zufriedenstellend sein. Wenn du die falsche Fährte nicht erklärst, gibt das nur Frust und es könnte das Gefühl entstehen, dass die Handlung „unfair“ war. Ein sehr gelungenes Beispiel sehe ich im Buch „Gone Girl“ von Gillian Flynn. Dort wird der Leser mehrfach getäuscht (Vorsicht Spoiler!). Zu Beginn glaubt man, dass Nick, der Ehemann, für das Verschwinden seiner Frau Amy verantwortlich ist. Gillian Flynn präsentiert zahlreiche Beweise, die diesen Verdacht bestätigen, nur um dann die Wendung zu liefern. Hier wird die falsche Fährte meisterhaft aufgelöst und liefert einen „Aha“-Moment für den Leser.
💡 Tipp für deinen Roman:
Plane frühzeitig, wie du die falsche Spur auflösen wirst. Die Auflösung sollte glaubwürdig sein und zu den bisherigen Ereignissen passen.
Häufige Fehler bei „Red Herrings“ und wie du sie vermeidest
1. Du platzierst zu viele falsche Fährten
Wenn du zu viele Ablenkungsmanöver in deine Geschichte einbaust, riskierst du, dass die Leserschaft überfordert ist. Anstatt Spannung aufzubauen, erzeugst du Chaos, und der eigentliche Plot wird schwer nachvollziehbar. Dann verliert die Leserschaft das Interesse. Halte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen echten Hinweisen und falschen Spuren. Beschränke dich zum Beispiel auf ein oder zwei gut platzierte falsche Fährten. Überlege dir genau, wie jede Ablenkung zur Gesamtstruktur der Geschichte beiträgt. Frage dich immer, ob die Hinweise auf eine interessante Weise ablenken oder nur für Verwirrung sorgen.
Die besten falschen Fährten stehen in Verbindung mit den tatsächlichen Hinweisen der Geschichte.
2. Deine Hinweise sind unlogisch
Ein „Red Herring“ sollte in der Welt der Geschichte glaubwürdig sein. Wenn die falsche Spur zu weit hergeholt wirkt, könnten deine Leser:innen das Gefühl bekommen, dass du sie absichtlich täuschen willst – das kann das Vertrauen in die Geschichte zerstören. Stelle sicher, dass jede falsche Spur eine plausible Grundlage hat. Wenn ein Charakter am Tatort war, könnte das einen realistischen Grund haben (vielleicht hat er etwas verloren und war zufällig dort). Sorge dafür, dass die falsche Spur zur Handlung passt und nicht willkürlich wirkt.
3. Du weckst falsche Erwartungen
Pass beim Plotten auf, dass die „Red Herrings“ nicht zu dominant sind. Wenn die falsche Spur spannender oder interessanter ist als die eigentliche Auflösung, könnte der Leser enttäuscht sein, wenn die Wahrheit ans Licht kommt.
Plane deine Geschichte so, dass die eigentliche Auflösung der Höhepunkt bleibt.
Möchtest du immer ganz nah dran sein an meinem Lektorinnennleben – dann hüpfe schnell in meinen Newsletter! Darin nehme ich dich regelmäßig mit hinter die Kulissen!
Mein Lieblings-„Red-Herring“: Bischof Aringarosa aus „The Da Vinci Code“
Da hat Dan Brown einfach etwas total Cooles gemacht! Er hat mit der Figur des durchtriebenen Bischofs Aringarosa in seinem Roman „The Da Vinci Code“ einen tollen „Red Herring“ geschaffen. Aber nicht nur das! Beim Schreiben seines Buches hat er sich den Spaß erlaubt, seinen Leser:innen gleich beim ersten Auftreten der Figur den entscheidenden Hinweis darauf zu liefern. Aber nur, wer ganz genau hinschaut und ein bisschen Italienisch kann, merkt es: „Aringa rossa“ heißt übersetzt nämlich roter Hering. Ist das nicht genial? 🤩
Bei dieser Figur ist der Name Programm: Gleich zu Beginn der Geschichte deutet alles darauf hin, dass Aringarosa der Bösewicht des Films ist – der große Gegenspieler, der die Fäden in der Hand hat. Und auch im weiteren Verlauf werden immer wieder Hinweise gestreut, dass er es sein muss. Er wird mit der ultrakonservativen katholischen Organisation Opus Dei in Verbindung gebracht, die im Roman als geheimnisvoll, machtvoll und kontrovers dargestellt wird. Außerdem wird Aringarosa als Mentor des fanatischen Mönchs Silas gezeigt, was ihn in den Augen der Leser zu einem möglichen Drahtzieher hinter den brutalen Morden macht, die Silas begeht.
Aber es wäre natürlich langweilig, wenn der Autor bei so einem Thriller, in dem es die ganze Zeit ums Rätselraten geht, gleich zu Beginn den entscheidenden Drahtzieher enthüllen würde. Klassischerweise ist es gerade im Thriller-Genre nicht so wie es scheint und zum Ende wartet eine DIE überraschende Wendung. So auch hier (Achtung Spoiler!): In „The Da Vinci Code“ stellt sich heraus, dass Aringarosa selbst nur ein Opfer einer größeren Verschwörung ist, die vom eigentlichen Antagonisten, Sir Leigh Teabing, gesteuert wurde. Teabing manipuliert nicht nur Aringarosa, sondern auch Silas, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Aringarosas vermeintliche Schuld wird in einem befriedigenden Aha-Moment aufgelöst, als der Leser erkennt, dass er in die Irre geführt wurde.
Warum ist Aringarosa ein so gelungener „Red Herring“?
- Emotionale Tiefe: Die Figur ist mehr als nur eine oberflächliche Ablenkung. Seine Motive und Handlungen sind komplex, und seine Liebe zur Kirche und zu Opus Dei macht ihn zu einer glaubwürdigen Figur.
- Plausibilität: Die falschen Fährten um Aringarosa sind logisch und passen zu seinem Charakter und seinen Zielen. Er handelt in Übereinstimmung mit seinen Überzeugungen, was ihn zu einem glaubwürdigen Verdächtigen macht.
- Auflösung: Die Aufklärung seiner Unschuld am Ende der Geschichte bringt nicht nur Klarheit, sondern auch emotionales Gewicht, da Aringarosa selbst zum Opfer wird.

Book, book, hurra! Das ist mein Motto als zertifizierte Lektorin, Schreibcoach und Romanautorin. Ich bin davon überzeugt, dass gute Bücher die Welt ein Stückchen besser machen. Deshalb kann es nicht genug davon geben! Seit 2021 helfe ich Autor:innen mit Empathie und Leichtigkeit dabei, Romane zu schreiben, die berühren, mitreißen und im Gedächtnis bleiben. Denn ich möchte, dass noch mehr tolle Geschichten den Weg hinaus aus den Schubladen zu den Menschen finden, glücklich machen und den Alltag vergessen lassen. Wenn ich nicht lektoriere oder coache, schreibe ich selbst Romane und Kurzgeschichten, die von Familienbanden und Freundschaften erzählen, die Geheimnisse und Lügen entlarven und wo Liebe alles verändern kann.
Meine Romane & Kurzgeschichten findest du hier.
Mehr über mich erfährst du hier

